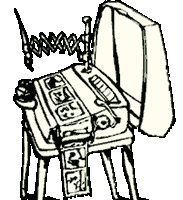Ein bisschen hatte ich ja Sorge, dass McCain doch noch die US-Wahl gewinnt, trotz der Voraussagen, nach denen Obama der klare Favorit war. WEIL Obama der Favorit war. Amerika liebt nämlich, wie es heißt, den Underdog, den Chancenlosen, der sich hochkämpfen muss, den Außenseiter, und der war zuletzt McCain. Auch Obama hat als Underdog angefangen. Das haben die Republikaner nie ganz demontieren können. Mich hätte trotzdem nicht überrascht, wenn viele Amis McCain gewählt hätten, nur um das System zu schlagen. Aber offensichtlich hat nicht jeder Außenseiter das Zeug zum Underdog, und ein Außenseiter mit sieben Häusern und wer weiß wievielen Autos bietet nicht wirklich viel Identifikationsfläche.
Aus europäischer Sicht erscheint es unplausibel, dass Underdogs in Amerika so beliebt sein sollen, schließlich treten die USA weltpolitisch eher großkotzig auf, und auch ihre Kultur belohnt nicht die Unabhängigkeit, sondern den Erfolg. Erfolg erscheint im amerikanischen Denken nie ungerecht oder verdächtig wie bei uns, sondern als Ergebnis harter Arbeit und als Erfüllung des Amerikanischen Traums, vom Tellerwäscher zum Millionär werden zu können oder zumindest zum glücklichen Tellerwäscher, je nachdem welche Ziele man sich setzt. Dass Leute in diesem System Erfolg haben, wird als Rückversicherung für alle anderen empfunden. (Vorsicht, dieses Amerikabild ist stark vereinfacht, nicht dass jetzt jemand damit hinfliegt und Probleme kriegt, und ich bin schuld.)
Amerikanische Helden, so die europäische Vorstellung, sind schon optisch keine Underdogs: muskelbepackt, familienorientiert, weiß. Definitiv keine Ex-Tellerwäscher. Was man in den High Schools die "Jocks" nennt, die Sport-Asse, die alle Chancen haben und zu denen alle aufblicken, so dass man sich fragt: Wieso eigentlich? Nur weil einer gut Football spielt, macht ihn das doch nicht zu einer moralischen Instanz. Wie passen die ins Bild? Hier ist jetzt die wirklich gute Nachricht: Immer weniger.
Früher hieß es, die Bösewichter seien die interessanteren Charaktere, sie kriegen die besseren Dialoge, die schickeren, weil schwarzen, Hüte und ein breiteres Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten. Das lag daran, dass die Guten halt fürs Gute standen und damit keine Rechtfertigung brauchten, die Bösen mussten uns erst noch überzeugen. Im Prinzip gilt das immer noch, aber in guten Geschichten steht heute weniger der Kampf Schwarz gegen Weiß im Vordergrund als die Auseinandersetzung verschiedener Grauschattierungen. Inzwischen müssen sich auch die Guten differenzieren, und das hat ihnen gut getan.
Zeichen der Zeit
Wie weit diese Entwicklung inzwischen fortgeschritten ist, fiel mir neulich auf, als im Fernsehen STARSHIP TROOPERS lief. Der Held ist ein klassischer Jock: Brav, fönfrisiert, kräftig, sauber. Ich hatte große Schwierigkeiten, ihn als Helden auch nur auszumachen, geschweige denn zu akzeptieren. In den Filmen und Serien, die ich sonst gucke, sehen so die Antagonisten aus: Die privilegierten, rücksichtslosen Society-Kids in VERONICA MARS, die Alliance-Offiziere in FIREFLY, Captain Hammer bei DR. HORRIBLE.
Vielleicht liegt es daran, dass heutige Fernsehserien (mir fällt es vor allem im Fernsehen auf) so viel differenzierter und erzählerisch reifer sind als frühere. Je mehr die Charakterfundierung sich entfernt vom leicht erkennbaren Bild (weißer Hut, Muskeln) und übergeht zur ausdifferenzierten Geschichte, umso mehr gewinnen die Helden, die eine Geschichte zu erzählen haben. (Dass diese Helden immer noch besser aussehen als die meisten Real-Life-Underdogs, ist ein Abstrich an die Konventionen des Fernsehens, den man einfach mal hinnehmen muss. Es wird sicher auch noch einige Zeit dauern, bis ein verzottelter Slacker oder ein Punk im Weißen Haus landet. Einer Real-Life-Ausgabe von Veronica Mars dagegen könnte ich es ohne weiteres zutrauen.)
Es gibt auch ältere Helden, die eigentlich Underdogs sind. (Früher haben wir das Anti-Helden genannt.) Philip Marlowe, Rick in CASABLANCA, Jim Rockford, der frühe Mickey Mouse. Im klassischen Drama ist der Held einer, der unüberwindbare Hindernisse überwindet und sogar bereit ist, sich selber zu opfern. Vom klassischen Drama kommt auch der Begriff der Hero's Journey, wonach der Held nicht als Held in die Geschichte geworfen wird, sondern erst durch die Prüfungen und Konflikte der Geschichte dazu wird.
Die falsche Lektion
Dass die klotzigen Über-Helden trotzdem nicht totzukriegen sind (hat jemand die neue FLASH GORDON-Serie gesehen?), liegt wahrscheinlich daran, dass sie die Aufmerksamkeitsspanne eines beiläufigeren Publikums besser bedienen als die "tieferen" Helden. Solche Helden wuppt man auch ohne große Fundierung. Sie sind ikonisch und gewissermaßen selbsterklärend. Man kann das bei unerfahrenen Autoren beobachten, die leichter mal auf diese Scheinplausibilität hereinfallen: Junge Comic-Aspiranten schaffen ihre ersten Helden, indem sie eine Figur zeichnen, die irgendwie cool wirkt. Wenn man sie dann nach deren Charaktereigenschaften und Fähigkeiten fragt, sagen sie: "Der ist cool, hat Humor, macht Wasser zu Wein und kann ganz schnell rennen, doll zuschlagen und ist auch noch hochintelligent." Kurz: sie packen alles, was sie cool finden, in diese Figur und hangeln sich von da weiter. Manchmal haben sie auch mitgekriegt, dass ein Held einen "fatal flaw" braucht, dann ist er vielleicht humorlos oder hat einen schlechten Klamottengeschmack. Oder, wenn es eine Manga-Figur ist, verliert er seine Kräfte, wenn Kirschblüte ist oder so.
Viele Schreibtutorials empfehlen sogar, Charaktere so aufzubauen: Fähigkeiten, ein Fatal Flaw, dazu noch bestimmte Ticks, und fertig. Dabei kommt natürlich nicht mehr raus als ein Setzkastenheld. Ich warne davor, das allzu ernst zu nehmen. Solche Anleitungen sind okay, wenn man schon eine Grundlage hat und noch irgendwas fehlt, aber sie bewirken noch keine guten Figuren.
Ich würde eher empfehlen, über den sozialen Zusammenhang zu kommen. Alle Menschen sind Produkte ihrer Umgebung. Wenn Du eine gute Vorstellung dieser Umgebung hast, kannst Du dir auch vorstellen, welche Eigenschaften Deinen Helden anders genug machen, um als Held hervorzustechen. Das kann nach "unten" oder nach "oben" sein, das Hervorstechen. Wenn der Held und seine Geschichte interessant sein sollen, empfehle ich aber, "unten" anzufangen.
Working Class Hero
Ihr müsst ja auch bedenken, dass eine Figur, die alles, was die anderen toll finden, besonders gut kann, eher überprivilegiert ist. Vielleicht nicht angepasst, aber er ist derjenige, an den sich alle anderen anpassen wollen. Das bietet kein Identifikationspotential, selbst wenn er kein arroganter Sack ist wie die meisten dieser Jocks: Wenn sich der Football-Quarterback beklagt, dass ihn niemand als sensiblen Menschen wahrnimmt, weil ihn alle nur wegen seiner körperlichen Überlegenheit bewundern, kann man schon zu recht fragen: Na und? Andere haben nicht mal das! Und da wird es interessant. Was tun die Unterprivilegierten, um angesichts dieser Schichtung ein würdiges Leben zu führen? Um doch eine aktive Rolle zu spielen? Welche Fähigkeiten bringen sie mit, um sich zu behaupten, und wo haben sie die her?
Ich selber habe eigentlich nur Underdog-Helden: Conny ist Außenseiterin und außerdem schlecht in der Schule, Reception Man wird weder als Superheld noch als Pförtner von irgendjemandem ernstgenommen, und TERRAIN VAGUE handelt ausschließlich von Subkulturen, angefangen bei Bianca, der Sprayerin. Na gut, Graf X ist so ein Überheld, aber der ist auch als Parodie auf die Heldencomics der Fünfziger angelegt. Supergute Geradeheraus-Helden kann ich wahrscheinlich gar nicht schreiben. Ich wüsste gar nicht, was ich über sie schreiben sollte. Naja, irgendwie schon. Ich würde anfangen, indem ich sie dekonstruiere. Soll sich aber keiner hinterher beschweren.